Meine Reise zu Beethoven - Christian Thielemann, IOCO - Buchrezension, 10.10.2020
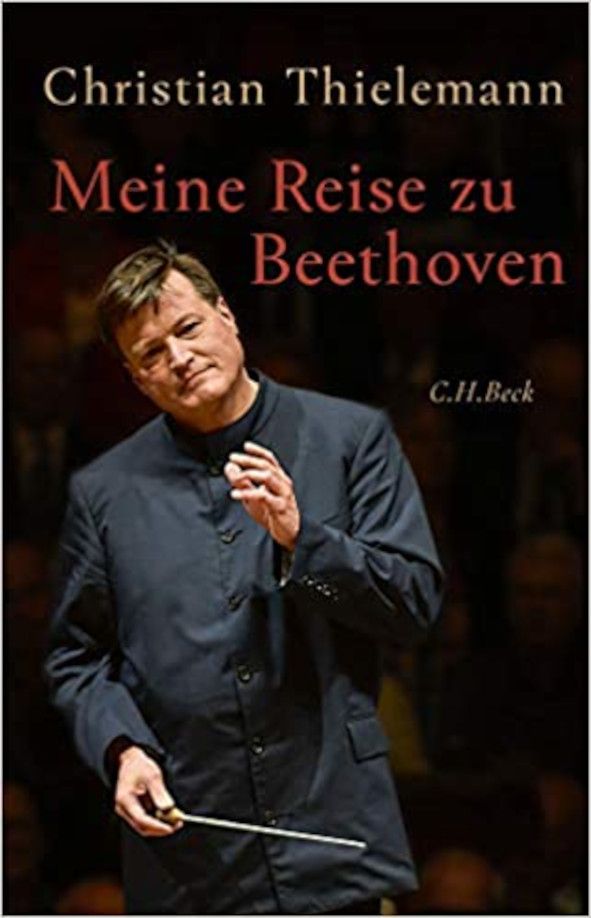
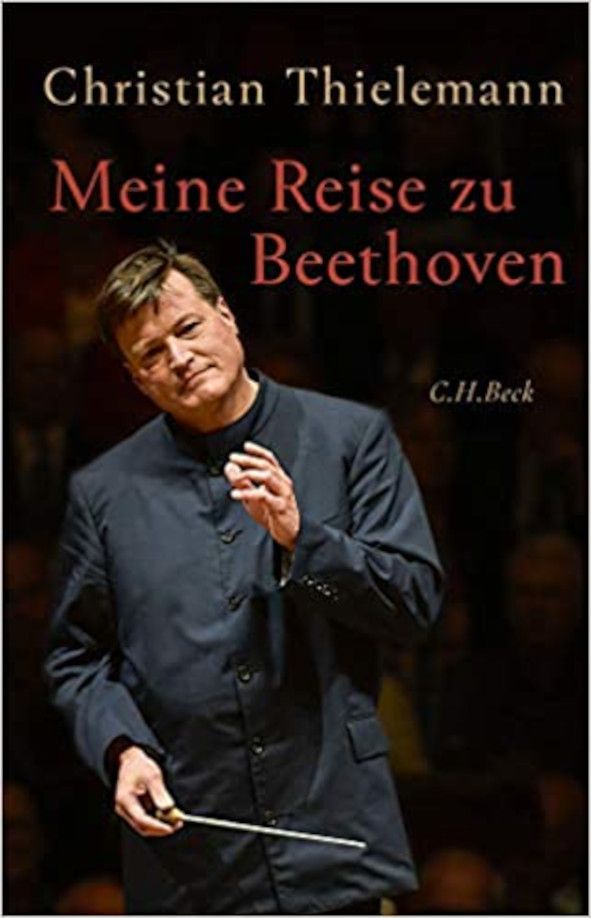
Buch von Christian Thielemann, Mitwirkung von Christine Lemke-Matwey
C. H. Beck Verlag, erschienen 2020. 271 S., 18 Abb., ISBN 978-3-406-75765-5, 22,00 € (Hardcover), 16,99 € (e-Book)
von
Julian FührerDie Bayreuther Festspiele (hoffentlich können sie 2021 wieder stattfinden!) haben seit dem Jahr 2000 einen musikalischen Aufschwung erfahren, der eng mit dem Namen Christian Thielemanns verbunden ist. Thielemann gilt international als Maßstäbe setzender Dirigent im sogenannten deutschen Fach: Nicht nur den Bayreuther Kanon der Werke Richard Wagners, auch die Opern von Richard Strauss und die Symphonien Anton Bruckners hat er mit großem Erfolg dirigiert. Thielemann ist vielseitiger, als ihm mitunter nachgesagt wird (Bach und Mozart gehören zu seinem Repertoire ebenso wie Marschner und Hans Werner Henze). Immer wieder hat sich Thielemann aber auch mit dem Werk Ludwig van Beethovens auseinandergesetzt und insbesondere die Symphonien einzeln und in Zyklen dirigiert. Aus dieser Beschäftigung ist das vorliegende Werk hervorgegangen, das ebenso wie Thielemanns Vorgängerbuch Mein Leben mit Wagner von 2012 auf Gesprächen mit der Journalistin Christine Lemke-Matwey beruht.

Noch mehr als in dem Wagner gewidmeten Buch wird Beethoven als unumgängliche Figur der Musikgeschichte präsentiert: „Alles, was Beethoven erfunden hat, begegnet uns später wieder. Bei Wagner, bei Brahms, bei Schönberg, bei allen. An Beethoven entscheidet sich alles.“ (S. 13) Angelegt ist es als ein imaginärer Durchgang zu den Zyklus der Symphonien, an vier aufeinanderfolgenden Abenden dirigiert: Worauf muss ein Dirigent achten, welchen Charakter hat welches Werk, welche Überlegungen erfordert speziell ein Zyklus? Recht häufig wird auf Vorbilder, Vorgänger, aber auch Kollegen geschaut: Welche Tempi hat Arturo Toscanini gewählt, was ist von den sehr rhythmischen Interpretationen Roger Norringtons und Simon Rattles zu halten, welchen Ansatz pflegte Herbert von Karajan bei seinen nicht weniger als drei Einspielungen der Symphonien (und was sind die Unterschiede der drei Aufnahmen)? Es wird deutlich, dass Thielemanns Interpretationen auf jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Werk und seinen unterschiedlichen Deutungen zurückgehen.
Beethoven trat erst als Symphoniker in die Öffentlichkeit, als er als Pianist und Komponist für das Klavier längst etabliert war. Beethoven war sich seiner Position als Komponist und Interpret bewusst. Bereits in der ersten Symphonie, die im Vergleich zu den späteren Werken auf uns einen fast harmlosen Eindruck macht, ist vieles zu finden, was für damalige Ohren und Gehirne neu war. Vieles war revolutionär und wirkte fremdartig, laut, verstörend. Im unmittelbaren Vergleich der Werke werden aufführungspraktische Probleme diskutiert, etwa die zwei brüsken Schläge, mit denen die dritte Symphonie, die sogenannte Eroica, einsetzt (S. 40):
„Was steht in den Noten? Zwei Akkorde, zwei Viertel, jeweils mit Punkt darüber, also kürzer zu nehmen. Oder kurz? Hätte Beethoven es kurz gewollt, hätte er auch Achtel schreiben können. Hat er aber nicht. Weil er darauf nicht so geachtet hat? Falsch! In der Siebten Symphonie – und hier kommt das „Ganze“ ins Spiel – schreibt er Achtel und Sechzehntel mit Punkt. Und sogar Achtel mit einer Sechzehntel-Pause. Also will er es immer ein bisschen anders, er differenziert. Für die Eroica bedeutet ein solcher Seitenblick, dass die ersten beiden Akkorde eben nicht ganz kurz sein dürfen, sondern einen (gedachten) Moment lang gehalten werden sollten.“
Im weiteren Verlauf werden auch Metronomzahlen diskutiert, aber auch die vielfältigen Akzente, Sforzati und Keile, die Beethoven wieder und wieder notiert – was meinen sie genau? Und meint ein Keil in der Partitur der ersten Symphonie dasselbe wie in der Neunten? Sollen die zweiten Violinen den ersten Geigen gegenübersitzen (die „deutsche“ Aufstellung) oder hinter ihnen? Manchmal werden also eher technisch scheinende Fragen behandelt. Die Hauptfrage bleibt jedoch immer im Zentrum: Wie wird man Beethoven gerecht, wie sollte man sein Werk dirigieren?
Sehr wertvoll für die Einordnung der Symphonien sind die immer wieder eingeflochtenen Seitenblicke auf das weitere Werk Beethovens, auf die 32 Klaviersonaten, die 16 Streichquartette, die fünf Klavierkonzerte, das Violinkonzert Opus 61. Es macht einen großen Unterschied, ob man Beethoven auf einem Flügel von Steinway oder einem aus dem Hause Bechstein (oder gar Bösendorfer oder Blüthner) spielt. Beethoven betonte oft die mittlere und tiefe Lage (möglicherweise ein Effekt seiner zunehmenden Hörprobleme), was durchaus eine Rolle für die Wahl des Instruments oder die Orchesteraufstellung spielt.

Dennoch ist das Werk gut lesbar, Thielemanns ‚Berliner Schnauze‘ kommt immer wieder durch wie hier (S. 212): „Das Stilmittel der Achten ist, flapsig ausgedrückt, die Veräppelung.“ Oder auch (S. 239): „Das cis-Moll-Quartett oder die Große Fuge sind absolut unverdauliche Ware. Und auch bei der Hammerklaviersonate scheint ihm […] so ziemlich alles wurst gewesen zu sein.“ (beides, ganz nach Berliner Art, durchaus positiv gemeint). Der Autor schreckt nicht vor persönlichen Wertungen zurück: Der Finalsatz der Neunten Symphonie habe Beethoven beim Schreiben wohl hörbar Spaß gemacht, kompositorisch sei das vorangehende Adagio jedoch überlegen. Natürlich geht es auch um Wagner. Wagner habe ihn gelehrt, so Thielemann, wie man Beethoven ökonomisch dirigiert. Und im Gegensatz zu Wagner, dessen Schriften und Privatleben ihn oft sehr unsympathisch erscheinen lassen, ist Beethoven als Anhänger der Französischen Revolution viel breiter akzeptiert – Ode an die Freude statt Walkürenritt. Dies bringt allerdings mit sich, dass seine Musik durchaus zu propagandistischen Zwecken eingesetzt wurde und wird, allerdings aus so verschiedenen Richtungen, dass Beethoven tatsächlich etwas Universelles hat. Nur – und damit endet das Buch schon fast – hat auch Beethoven neben seinen ungeheuren Stärken und seine Schwächen. Ein Komponist für die menschliche Stimme war er nicht, die Partien der Neunten Symphonie, der Missa solemnis und des oftmals umgearbeiteten Fidelio sind teils undankbar, teils obendrein ungemein schwer zu singen. Und die leichte Muse stand ihm nicht zu Gebote (S. 257): „Seine Musik kann bissig sein, ironisch, hintersinnig – richtig witzig oder albern im guten Sinn ist sie nie. Beethoven hat Humor. Leichtsinn aber kennt er nicht.“
Das Buch ist mit einigen Abbildungen (unter anderem S. 37 einem wüst aussehenden Autograph aus der Fünften Symphonie) angereichert, und am Ende zeigt das Personenregister noch einmal, in welcher Breite die geistige Auseinandersetzung mit Beethoven hier geführt wurde. Der Band ist auf höchstem Niveau lektoriert. Vor den technischen Passagen dieses Buches sollte man sich (anders als bei Beethovens Kompositionen) nicht fürchten, und jeder, der dieses Buch in die Hand nehmen, wird etwas Neues, Überraschendes finden. Der sehr persönlich gehaltene Blick Christian Thielemanns auf Ludwig van Beethoven ist eine Bereicherung.
---| IOCO Buchbesprechung |---





