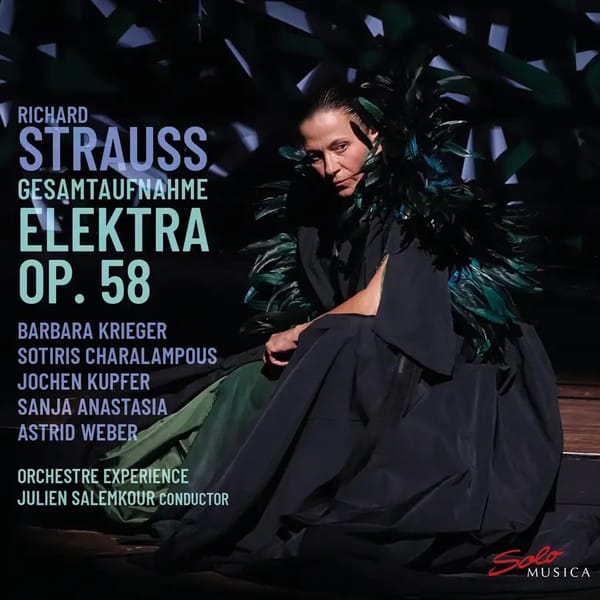Dresden, Semperoper, 74. GEDENKKONZERT-MESSA DA REQIUEM - G. Verdi, IOCO

12. Februar 2025 - Verdis „Requiem“ im 74. Dresdner Gedenkkonzert - Professionelles Dirigat Daniele Gattis und hervorragende Interpreten sicherten ein beeindruckendes Erinnern

Seit Rudolf Kempe (1910-1976) im ersten „Konzert zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945“ im damaligen „Großen Haus der Staatstheater“ eine Aufführung von Giuseppe Verdis (1815-1901) „Messa da Requiem“ der Sächsischen Staatskapelle leitete, ist dieses Werk die am häufigsten in dieser Abfolge aufgeführte Komposition. Mit Daniele Gattis Interpretation erlebten wir am 12. Februar 2025 die 22. Jahrestags-Darbietung der Dresdner Staatskapelle in den inzwischen 74 Jahren des Bestehens der Tradition.
Dabei hat auch Verdis „Messe da Requiem“ eine nicht geradlinige Entwicklungsgeschichte: als Gioaccino Rossini (1792-1868) verstorben war, organisierte der, ob des Verlustes für die italienische Kultur beeindruckte Verdi, eine Gemeinschaftskomposition der führenden Tonschöpfer des Landes. Eine „Messe da Rossini“ sollte entstehen und am 13. November 1869, dem ersten Todestag Gioaccino Rossinis in Bologna aufgeführt werden. Nicht nur kostenfreie Mitwirkung, sondern auch ein Unkostenbeitrag wurde von den Agierenden erwartet.
Verdis Überschätzung des Idealismus seiner Musikerkollegen sowie Intrigen und Eifersüchteleien verhinderten die Aufführung und die fertige Partitur verschwand für fast 119 Jahre im Archiv und wurde erst 1988 in Stuttgart uraufgeführt.
Als der von Verdi hochverehrte Schriftsteller und Humanist Alessandro Manzoni (1785-1873) verstarb, entnahm Verdi seinen Beitrag der Rossini-Messe mit dem Textteil „Libera me“ und komplettierte sein Requiem für den Bewunderten. Die Erstaufführung am Jahrestag des Versterbens Manzonis in der Kirche San Marco in Mailand wurde zum Beitrag der liturgischen Zeremonie. Es entstand eine eigenartige Kombination von Teilen Verdis „römischer Ritus-Messe“, die sich mit dem Zelebrieren des „ambrosianisch-gregorianischem Ritus“ der Kirche abwechselte. Immerhin erlaubte der Erzbischof, dass Frauen singen durften, obwohl der Feierlichkeit Diskussionen im Bürgerrat wegen der ungewöhnlichen Lösung voran gegangen waren.
Am Vorabend des 80. Jahrestages der Zerstörung der bis dahin verschonten Stadt erlebten wir Guiseppe Verdis „Messe da Requiem“ mit Daniele Gatti im vor 50 Jahren wiedererstandenen Semperbau.
Wie aus dem Nichts kamen gedämpfte Streicher mit ihrer dämmrigen Stimmung und das Gemurmel der Worte „Requiem aeternam“, ewiger Frieden, des Chores schienen am Beginn von Irgendwo des Saales zukommen, sodass man sich ihrer Wirkung nicht entziehen konnte.
Vom Beginn an dirigierte Gatti offen und zügig. Sicher führte er den verstärkten Sächsischen Staatsopernchor und die Staatskapelle sowohl bei den wuchtigen Entladungen als auch in den ruhevolleren Abschnitten zu einer perfekten Einheit zusammen.
Das Orchester behauptete sich in der intelligenten Auslegung der Komposition als hochprofessionell musizierender Klangkörper mit hervorragenden stilistischen Fähigkeiten. Wie selbstverständlich beherrschte der von Jan Hoffmann exzellent mit den Görlitzer Gästen vorbereitete Chor souverän die breiten polyphonen Interaktionen in allen Teilen.

Nach und nach brachte Gatti seine Sänger ins Spiel. Alle vier aufgebotenen Solisten waren mit höchst charakteristischen und aufeinander abgestimmten, sich ergänzenden Stimmen ausgestattet. Die Sopranistin Eleonora Buretto, geboren in Mantua, phrasierte mit schlanker Klarheit und nutzte ihre hervorragenden technischen Mittel nach Belieben aus. Der dunkel und warm timbrierte Mezzosopran der aus dem Balatongebiet stammenden Szilvia Vörös beeindruckte besonders in den voluminösen Tiefen. Der Genueser Francesco Meli konnte mit hoher Spannkraft und tonoraler Stabilität aufwarten. Souverän mit würdevoll charismatischer Haltung setzte Michele Pertusi seine kernigen Bassakzente.
Konzentriert, mit Formgefühl und Stilempfinden statt mit auffallendem Pathos, waren die Solisten in ihren Aufgaben zu erleben.
Der zweite, der sieben Teile des „Messa da Requiem“, das „Dies irae“, der Tag des Zorns, führte mit seinem musikalischen und sprachlichen Bilderreichtum zu einem großen dramatischen Bogen. Hammereinsätze der Blechbläser und wuchtige Schläge der großen Trommel eröffneten den von Gatti grandios beherrschten Wechsel des atemberaubenden Ineinander von Solisten und Chor. Der musikalische Satz wirkte trotz der massiven Klangentfaltung nie intransparent. Die Übergänge zwischen den klangbetonten und den polyphonen Stellen blieben stets fließend.
Tränenreich schlossen Chor und Solisten das Lacrymosa.
Gattis reiche Requiem-Erfahrung sicherte, dass nach dem gewaltigen „Dies irae“ mit dem vom Solistenquartett prachtvoll gesungene „Offertorio“, dem Opfergang, das zu Hörende nicht zerfaserte, die Seelen der treuen abgeschiedenen von den Strafen der Höllen befreit werden konnten und auch die Segnung des gewaltigen Doppelchores des „Sanctus“ die Möglichkeiten ihrer Entfaltung erhielten.
Wie eine Retardierung sangen dann in beklemmender Harmonie Eleonora Buretto und Szilvia Vörös mit sparsamster instrumentaler Unterstützung „Agnus Dei“, das Opferlamm Gottes, zur Würdigung Jesu.
Ewiges Licht und ewige Ruhe erbaten die Mezzo-Sopranistin und die beiden Männerstimmen mit dem „Lux aeterna“ für Jene, denen die Messe gewidmet ist.

Nirgendwo war der unkonventionelle Umgang mit der Liturgie so deutlich, wie im finalen „Libera me“, als die Sopranistin Eleonora Buratto nach einer rezitativartigen Passage ein flehendes Arioso folgen ließ und nach den donnernden fünf Basstrommelschlägen der Chor die Apokalypse ankündigte.
Es war nicht das Werk eines Komponisten, der in der Tradition der geistlichen Musik gearbeitet hatte, sondern die Inspiration eines großen Künstlers aus einer anderen Welt, der sein ganzes Können in den Ausdruck von Todesangst und Trauer geformt hatte. Da gab es keine himmlische Heiterkeit, keinen tröstenden Jesus gegen die Angst vor dem Tode.
Daniele Gatti hatte nicht versucht, mit seinem Dirigat jene Worte der Liturgie zu glätten, die ihr die Komposition zugemessen hatte. Er verstärkte sogar den rohen Schrecken, den Verdi mit seinem Werk vermitteln wollte und erreichte damit eine grandiose Wirkung seiner Interpretation. Diesem „Verdi-Requiem“ konnte man sich nicht entziehen, auch wenn das Respektlose des Werkes gegenüber der Religiosität betont war.
Eine einfühlsame, äußerst differenzierte unter die Haut gehende Leistung Daniele Gattis, mit der er sich die Anerkennung seines Dresdner Publikums gesichert haben dürfte.