Reiner Goldberg, Tenor - Sein Leben und Wirken, IOCO Interview, 28.07.2018



Tenor Reiner Goldberg - Leben und Wirken - Teil 1
Von Michael Stange
Reiner Goldbergs Karriere als Sänger begann 1967, in Dresden. Mit Beginn der achtziger Jahren begeisterte er mit metallischem Timbre, glänzender Tonhöhe und intensiver Gestaltungsfähigkeit auch jenseits des Eisernen Vorhangs. International bekannt wurde der aus Crostau (Oberlausitz) stammende Tenor der Deutschen Staatsoper Berlin spätestens mit seiner Einspielung des Parsifal im Jahre 1981; mit dem Soundtrack des Syberberg Parsifal-Films. Diese Einspielung mit Rainer Goldberg, eine der ersten digitalen Parsifal-Aufnahmen überhaupt, ist, laut dem anerkannten Musikkritiker Jürgen Kesting, eine der überzeugendsten Parsifal-Einspielungen auf dem Markt. 1985 sahen Millionen Zuschauer Reiner Goldberg bei der Fernsehübertragung der Eröffnung der Dresdner Semperoper als Max im Freischütz. Spätere große Partien waren Aaron in Moses und Aaron, Herodes in Salome und Hauk-Sendorf in Die Sache Makropulos. Hohe Klickzahlen bei YouTube, spotify und anderen Streaming-Anbietern belegen Rainer Goldbergs bestehende hohe Popularität. Gründe genug für IOCO-Korrespondent Michael Stange, mit Reiner Goldberg über seine Karriere, Stimmen und seine Erfahrungen als Gesangspädagoge zu sprechen.

Herr Goldberg, Sie wurden 1939 sechs Wochen nach Beginn des zweiten Weltkriegs in Sachsen geboren. Wie haben Sie Ihre ersten Lebensjahre erlebt?
Ich bin im Oberlausitzer Bergland in Crostau in der Nähe von Bautzen geboren worden. Mein Vater Fritz war Webermeister und damals schon im Krieg. In unserer Gegend waren die Menschen sehr arm und lebten meist vom Weben von Stoffen. Gerhard Hauptmann hat das Elend dieser Menschen in seinem Stück Die Weber ja Anfang des 20. Jahrhunderts anschaulich beschrieben. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerung ist, dass meine Mutter mich nachts weckte und wir vor unserem Haus von Fern den Feuerschein des brennenden Dresden sahen. Es war ein schreckliches Bild. In unserem Dorf stand vor jedem Haus ein Fahnenmast. Alle mussten zu Hitlers Geburtstag am 20. April 1945 die Hakenkreuzfahnen hissen. Ein Wahnsinn, weil wir ja durch das brennende Dresden und die vielen Flüchtlinge wussten, dass der Krieg bald vorbei sein würde.
Nach dem Krieg war eine schwere Zeit. Wir sind geblieben, weil mein Großvater nicht fliehen wollte. Wir Kinder hatten dauernd Hunger und streunten herum. Da kam die Schule viel zu kurz.
Unsere Familie wohnte gemeinsam in einem Haus. Ganz oben unter dem Dach wohnte meine Großmutter. Sie passte auf einen Schlüssel auf und wenn jemand spät ohne Schlüssel nach Hause kam klopfte er laut an die Regenrinne, damit sie ihm den Schlüssel hinunter warf. Natürlich erboste sie, dass sie häufig aufgeweckt wurde und aufstehen musste. Sie fluchte dann laut in ihrem herrlichen Oberlausitzer Dialekt und warf schimpfend den Schlüssel herunter. Im Jahre 1949 klopfte mein Vater an die Regenrinne, der aus jugoslawischer Kriegsgefangenschaft heimkam. Das war eine der glücklichsten Erinnerungen meiner Kindheit, als nachts der Papa heimkam.
Nach der Schule musste ich etwas Praktisches anfangen. Ich begann eine Lehre als Schlosser. Daran habe ich wegen des Lärms und des Drecks keine guten Erinnerungen. Später wurde es besser, am wohlsten fühlte ich mich in der Schmiede aber ich hatte eben nur die Musik im Kopf.
Einige Ihrer Familienmitglieder waren Musiker, so dass Ihnen die Musik in die Wiege gelegt wurde. Wie und wann kam es zu Ihrem Entschluss Musiker zu werden und wann war für Sie klar, Sänger zu werden?

Musik hat mich schon als Kind begeistert. In unserer Kirche in Crostau haben wir eine Orgel, die im 16 Jahrhundert von dem berühmten Orgelbauer Gottfried Silbermann gebaut wurde. So lange ich mich erinnern kann, auch schon als kleines Kind und nach den Schulstunden habe ich Stunden in der Kirche zugebracht und der Orgel zugehört. Auch heute noch ist das für mich die schönste Orgel der Welt. Von unserer Orgel war ich so begeistert, dass ich zu Hause als vier- oder fünfjähriger selbst Orgel gespielt habe. Wie das ging? Wir hatten einen Holzkohleherd. Dieser Herd hatte einen Backofen, wo man das Fach zum Zubereiten der Backwaren herunterklappen musste. Auf diese Klappe legte ich mein Bilderbuch und setze mich in den Kohlekasten. Dann spielte ich Orgel, indem ich die Nieten, die die Backschublade zusammenhielten als Tasten benutzt. Meine Großmutter war sehr musikalisch und hat mit ihrer schönen Stimme viel gesungen. Mein Vater spielte neben seiner Arbeit Trompete. Seine Brüder waren auch sehr musikalisch, sein Bruder Otto spielte Posaune am Stadttheater Bautzen und der Bruder Rudolf Klavier. Ich war auch sehr früh Mitglied in einem Posaunenchor wo ich zuerst Waldhorn und dann Trompete spielte, so dass Musik meinen Alltag prägte.
Oper und Arien im Radio gab es nach meiner Erinnerung nicht. Mit klassischer Musik kam ich erstmals in einem Hotel in der nahe gelegenen Stadt Schirgiswalde in Berührung. Im dortigen Festsaal führten die Landesbühnen Radebeul sowie die Stadttheater Bautzen und Zittau Opern wie die Entführung aus dem Serail und den Postillion von Lonjumeau sowie Operetten auf.
Mein erstes großes Opernerlebnis war der Don Giovanni in Dresden 1955. Jemand hatte Karten besorgt und ein Freund und ich sind mit dem Zug dahin. gefahren. Die Musik und die Aufführung haben einen unglaublichen Eindruck gemacht. Don Giovanni war Arno Schellenberg und den Leporello sang Theo Adam. Natürlich fuhr nach der Aufführung kein Zug mehr nach Hause, so dass wir bis in die Frühe auf dem Bahnhof bleiben mussten. Das Erlebnis blieb mir trotzdem unvergesslich.
Die Arbeit als Schlosser wurde zwar nach der Ausbildung leichter aber ich wollte singen. Mit unserem Posaunenchor haben wir zu einem achtzigsten Geburtstag gespielt. Einer der Gäste sagte: „Mensch Reiner, sing doch was.“ Dann hat mich ein Bekannter, der Musiker in Zittau war, auf dem Akkordeon begleitet, ich sang O Sole mio auf Deutsch und die Gäste waren aus dem Häuschen. Man sagte mir: „Du hast aber eine schöne Stimme, lass Dich doch ausbilden.“ Damit waren die Würfel für mich gefallen.
Erste Stunden Gesangsstunden haben Sie privat in Bautzen genommen und sind dann in im Sorbischen Ensemble als 1. Tenor engagiert worden. Wie kam es dazu?
Ich hatte keine Ahnung wie das mit der Gesangsausbildung gehen sollte und bin zum Theater nach Bautzen gefahren, um einen Lehrer zu suchen. Da sagte man mir, die studieren alle noch selbst, aber am Ende gab man mir die Adresse einer alten Dame im Ort. Der habe ich vorgesungen und sie sagte mir: „Sie sind Tenor.“ Das war für mich überraschend, weil ich glaubte, Bass zu sein. Die Dame war auch gleichzeitig Stimmbildnerin des Sorbischen Ensembles. In unserer Gegend siedeln seit mehr als 1000 Jahren Slawen, die so genannten Sorben. Das Nebeneinander beider Kulturen also des Slawischen und des Deutschen hat eine lange Tradition. Für die Kulturpflege gab und gibt es neben vielen Vereinen noch heute das so genannte Sorbische Ensemble.
Meine Bautzener Stimmbildnerin verschaffte mir dort ein Vorsingen und ich sang die Arie des Max aus dem Freischütz. Mein Vorsingen der Arie endete bei „…Agathes Liebesblick“. Der Intendant starrte mich ungläubig an und rief: „Und weiter? Das Stück geht doch weiter!“ Ich antwortet: „Das weiß ich doch nicht.“ Mir war das eben nicht klar, weil ich nur diese verkürzte Fassung kannte.
Den Vertrag als Erster Chortenor bekam ich trotzdem. Oh war mein Vater böse. „Singen ist doch kein Beruf. Wie kannst Du nur?“ Als er dann aber hörte, dass ich fünfzig Mark mehr verdiente als in der Schlosserei willigte er wütend ein. Das habe ich ihm durch viele spätere Opernabende vergolten. Oh wie glücklich und stolz waren meine Eltern, später, wenn sie mich auf der Bühne sahen.

Arno Schellenberg war Ihr Lehrer in der Musikhochschule. Wie verlief Ihre Ausbildung und wie haben Sie Ihre Stimme gefunden?
In das sorbische Ensemble kam eine neue Stimmbildnerin, der meine Stimme auffiel. Sie sagte mir, ich solle ihrem Professor Arno Schellenberg vorsingen. Dorthin fuhr ich im Winter bei Schnee und Eis mit dem Motorrad. Er hatte den Termin vergessen, hörte mich an und sagte: Naja, probieren wir es mal. Das Gremium der Hochschule musste er für meine Aufnahme dort mit dem Hinweis überreden: Wir brauchen doch Tenöre.
Vieles, wie das Hochziehen der Kehle und das Pressen der Stimme gewöhnte er mir sofort ab. Meine stimmliche Ausbildung hat aber sehr lange gedauert. Große Schwierigkeiten machte die Atemtechnik, die er mir vormachte, weil ich nicht verstand, was er wollte. Die ersten Jahre ging es überhaupt nicht voran. Ich wollte aufhören. Mit einem Mal sehe ich im Fernsehen einen Meisterkurs Gesang mit dem berühmten Kavaliersbariton der dreißiger Jahre Willy Domgraf-Fassbaender. Er erklärte seinen Schülern: „Ihr müsst locker sein, bis in die Zehenspitzen. Ruhe in den Körper und in den Atem bringen.“ Ich hatte das so noch nie gehört. Es klang einfach, den Mund locker und unverkrampft lassen und die Stimme mit dem Atem führen. Nach einigem Probieren zu Hause gelang es mir und plötzlich ging die Stimme wie eine Rakete in die Höhe.
Meine Kommilitonen fragten mich: Was ist denn mit Dir passiert? Die wollten dann natürlich immer ein hohes C hören. In Dresden gab es damals gegenüber dem Neustädter Bahnhof eine Kneipe, die „Alt-Dresdner Weinstube“. Dort gingen wir hin, da gab es auch einen Pianisten und ich sang öfter die „Postillion Arie“ mit dem hohen D. Durch derartige Eskapaden und das viele Üben bildeten sich bei mir Knötchen auf den Stimmbändern. Ich musste operiert werden und fast wäre alles vorbei gewesen. Danach hat mich Arno Schellenberg ganz langsam wieder an das Singen geführt und ich bin vorsichtiger geworden.
Sie gelten als Freund des Hörens von Aufnahmen von Sängern der Vergangenheit und als sehr selbstkritisch. Jürgen Kesting - der Gesangsexperte - vergleicht Ihren Parsifal auf CDs mit dem Tenor Franz Völker.
Welchen Vorteil haben das Abhören eigener Aufnahmen und die Beschäftigung mit Aufnahmen großer Rollenvorgänger?
In meiner Studienzeit wohnte ich mit drei Kollegen in einem Zimmer. Wir waren alle sehr musikverrückt und hörten von älteren Kollegen Namen wie Franz Völker, Max Lorenz, Lauritz Melchor. Leo Slezak und viele andere. Wir wussten nichts von diesen Stimmen und hatten sie noch nie gehört.
In der DDR gab es keine Platten von historischen Sängern und im Rundfunk wurde auch nichts gesendet. Ein älterer Kollege erzählte uns dann von den Schellackplatten und wir sammelten uns diese Platten bei alten Leuten zusammen. Wir saßen dann nächtelang neben unserem Plattenspieler und hörten diese Platten, um zu verstehen, was die Sänger mache, wo sie atmen, wie sie mit schwierigen Stellen umgingen und welche Kniffe sie verwendeten.
Gerade für das Erlernen der Atemtechnik ist das Hören alter Schallplatten unglaublich wichtig, weil die Sänger der Vergangenheit davon viel mehr verstanden als wir heute.
Heute spiele ich meinen Schülerinnen zum Beispiel Platten von Elisabeth Rethberg vor. Bei Ihrer Aufnahme der Arie "L'amero saro constante" aus Il Re pastore hört man, wo sie den Atem setzt. Sie macht das so geschickt, dass sie dadurch die Schwierigkeiten der Arie viel besser meistert und sich nicht überanstrengt. Das ist für eine wortdeutliche und technisch gute Interpretation wichtig, dass man eine optimale Gesangslinie und Gestaltung erreicht ohne sich auszupowern und die Stimme zu verschleißen.
Ich habe immer Kollegen zugehört und von vielen gelernt. Einen der letzten Tipps hat mir Herbert von Karajan gegeben: „Nutzen Sie die kleinen Pausen zum Entspannen. Schöpfen Sie Kraft aus dieser Entspannung.“ Wenn ich darauf nicht gehört hätte, hätte ich meine Siegfriede nie durchgehalte und wäre im 3. Akt nicht fit genug gewesen, um gegen Brünnhilde bestehen zu können.
Nur wenn man sich ständig hört und überwacht kann man sich verbessern und Fehlentwicklungen vermeiden. Ich halte das für unverzichtbar.
Was waren Ihre ersten Rollen in Radebeul und Dresden?
Im Jahr 1965 neigte sich meine Ausbildung dem Ende entgegen und ich wollte mich in Radebeul vorstellen. Man sagte mir dort sei Montag immer Vorsingen und ich fuhr dort hin. Als ich den Theaterpförtner ansprach, sagte er mir: „Neeee, die sin alle grank, heite is keen Vorsingen. Aber wo Se schon eenmal da sin…“. So konnte ich vorsingen, wurde engagiert und debütierte als 1. Geharnischter in der Zauberflöte. Nun war ich ganz kurz im Ensemble als der 1. Tenor kündigte. Daher wurde ich gefragt, ob ich im Sommer auf der Felsenbühne Rathen den Simon im Bettelstudenten singen kann. Das habe ich natürlich gemacht. Nach der 1. Vorstellung habe ich mich wie Caruso gefühlt. Das ging dann so weiter mit Puccinis Mantel bis zum Max im Freischütz.
Ich habe auch Cavalleria, Traviata, Faust und viel Operette, Rundfunk und Messen gesungen. So kam es zum Gastspiel als Max in Dresden, wo ich seit 1969 gastweise und seit 1972 fest engagiert wurde. Hinzu kam im gleichen Jahr Berlin.

Mit Hans Pischner stand einer der bedeutendsten Theatermänner der Nachkriegszeit an der Spitze der Staatsoper. Hat er oder die Intendanz der Staatsoper Berlin mit Ihnen über Ihre künftige Entwicklung gesprochen und wann man sie wofür einsetzen wollte?
Hans Pischner war ein Theatermann der alten Schule. Er war für uns wie ein Papa. Er kannte jedes seiner Ensemblemitglieder ganz genau, beobachtete sie intensiv, gab ihnen Tipps für die weitere Entwicklung, wusste wo er sie einsetzen und wie er sie fördern konnte und schuf eine familiäre gute Atmosphäre.
Er hielt zu Regisseurinnen wie Ruth Berghaus, von denen er überzeugt war und zu seinen Sängerinnen und Sängern. Er hatte sehr konkrete und praktische Ideen, was er machen wollte und wie er seine Ziele umsetzen konnte ohne sich den Staat zum Feind zu machen.
Es hat mit mir über die ersten Rollen gesprochen, welche Rollen bald in Betracht kamen. Ich sang so verschiedene Partien wie den Tambourmajor im Wozzeck, den Erik im Fliegenden Holländer, den Fenton in Falstaff, den Faust in Margarethe, den Alfred in Traviata und vieles mehr.
Pischner liebte Webers Oberon. Bei allen Opern hat er von den Stimmen und der szenischen Umsetzung eine so konkrete Vorstellung, dass er auf bestimmte Werke lieber verzichtete, als dass er Kompromisse machte. Bald nachdem ich in Berlin anfing sagte er mir, dass wir das machen werden und er mich als Hüon wolle. Die Inszenierung machte dann 1976 Luca Ronconi, der auch 2001 in Turin den Lohengrin inszenierte, in dem ich mitwirkte. Die Bühnenbilder waren sehr romantisch und zauberhaft. Ronconi liebte bewegliche Dinge auf der Bühne also den Schwan in Lohengrin und das Schiff im Oberon. Im zweiten Teil einer Oberon Aufführung der siebziger Jahre erreichten wir, also Celestina Casapietra und ich die Höhle an der Seeküste mit dem Schiff wie immer. Auf einmal kippt das Schiff um. Die Casapietra, die ja ein wenig mimosenhaft war und ihre Allüren hatte, schrie: „Ich kann nicht mehr ich trete ab.“ Darauf habe ich sie auf den Felsen gezerrt, mit Mühe und Not die Prechiera „Vater hör' mein Flehn' zu Dir“ gesungen und die Vorstellung ging mit umgekippten Schiff weiter. Böse war sie aber zum Schluss, doch haben wir sehr gelacht.
Kurz nach seinem hundertsten Geburtstag habe ich Pischner noch getroffen einmal und er hat mich sofort erkannt, mich umarmt und gerufen: „Ach mein Hüon.“
Im Wagnerfach hat er mich gesehen, aber er hat mir geraten, mir viel Zeit zu lassen und mich in Ruhe vorzubereiten. Für mich war diese gute Obhut sehr wichtig, weil ich oft an Lampenfieber litt. Die Intendanten in Berlin und Dresden und ich waren einig waren, dass die Stimme nicht überfordert werden darf, man keine Stücke außerhalb der aktuellen eigenen Möglichkeiten singt oder die Stimme überanstrengt. Der Umgang mit der Stimme ist etwas wo man aufpassen kann und muss.
Ein anderer Punkt sind die körperlichen Voraussetzungen, die man nicht ändern kann. Jahre nach der Aufnahmeprüfung in der Hochschule zeigte mir zum Beispiel die Theaterärztin meine Akte. Im ärztlichen Befund der Hochschule stand: „Asymmetrische Anordnung der Stimmbänder. Zum Singen untauglich“. Als sie mir das vorlas, war ich aber schon Kammersänger und singe noch heute.
Eine Ihrer ersten Rollen in Berlin waren Meyers Reiter der Nacht? Davon gibt es sogar eine Schallplatte. Was hatte es damit auf sich?
Das war eine hochpolitische Sache, Meyer war Präsident des Musikrates der DDR, ZK Mitglied und die Oper prangerte die Zustände der Apartheit in Südafrika an. Ich sang dort den Mako. Die Musik war wenig wirksam und das Werk so schlecht besucht, dass in den nächsten Spielzeiten die Zahl der Aufführungen drastisch reduziert und das Werk zum Schluss ganz abgesetzt wurde. Für mich erwies sich die Produktion aber als Glücksfall, weil ich dadurch um den Militärdienst herumkam. Eigentlich war ich gerade einberufen worden, musste aber in dieser Produktion singen, die als politisch besonders wichtig galt. Das hat dann unser damaliger Verwaltungsdirektor mit den Behörden geregelt und ich habe vom Militär nie wieder gehört.
Die Staatsoper Berlin verfügte insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren über ein hochkarätiges Ensemble mit Theo Adam, Peter Schreier, Anna Tomowa-Sintow, Gisela Schröter, Celestina Casapietra, Siegfried Vogel und anderen großen Sängern. Sogar der berühmte Bassist Pavel Lisitsian war öfter in Berlin. Wie waren die Zusammenarbeit und die Atmosphäre und wie haben Sie in ihrer sängerischen Entwicklung davon profitiert?
Das waren wirklich eine Ansammlung wunderschöner Stimmen und ein unglaublicher kollegialer Zusammenhalt. Wir waren eine große Familie haben uns geschätzt, uns unterstützt und hatten zueinander ein ausgezeichnetes Verhältnis. Ich habe mir viel angehört und viel von den Kolleginnen und Kollegen gelernt. Theo Adam war beispielsweise ein großer Gestalter mit intensiver Wirkung und Ausstrahlung. Der Vorteil dieses Ensembles war eben der Zusammenhalt und der gemeinsame Wille, schöne Kunst zu gestalten und das Publikum glücklich zu machen.
Pavel Lisitsian hat mich durch seine strömende klangschöne Stimme beeindruckt. Nach ein paar Gesangsstunden stellte ich fest, dass seine Technik nicht mit meinen Vorstellungen korrespondierte. Er war ein entzückender Mensch und wir wurden gute Freunde. Er veranstaltete immer offene Gesangsklassen, zu der mehrere Schüler kamen. Einmal brachte ein Kollege seinen fünfjährigen Sohn mit, dem der Unterricht nicht gefiel und der einen furchtbaren Krach machte. Da hat ihn Lisitsian auf sein Knie genommen, ihn beruhigt und ihm danach Unterricht gegeben. Das hat gut geklappt und der Kleine hat bestens mitgemacht. Das ist ein Beispiel für die gute damalige Atmosphäre und wie wir die Zeit an der Staatsoper erlebt haben.
Den Siegmund hatten Sie um 1972 in Dresden gesungen. Wie sind Sie damals als eher lyrischer Tenor mit dieser Partie zu Recht gekommen? Haben Sie sich damals schon gewünscht, dass Wagner einer der Schwerpunkte Ihres Sängerlebens werden sollte und haben Sie sich mit Rollenvorgängern wie Ernst Gruber oder Anderen ausgetauscht?
Das war ein Zufall, weil ein Kollege ausgefallen war. Damals lag mir die Rolle ein wenig zu tief und ich fand sie auch zu dramatisch. Aber die Vorstellungen mussten ja stattfinden und so habe ich das dreimal gemacht. Komischerweise war das nach dem Freischütz auf Anstellung in Dresden meine zweite Rolle.
Dazu muss ich eine Geschichte erzählen, weil Sie Ernst Gruber ansprechen. Ich habe die Walküre das erste Mal in Dresden 1959 gehört. Mein Onkel hatte Karten besorgt, Ernst Gruber – den ich noch heute sehr bewundere – sang den Siegmund und es war das zweite oder dritte Mal, dass ich eine ganze Oper hörte. Es war auch mein erster Wagner. Nun wurde ich im ersten Akt ein wenig unruhig, weil es mir zu lange dauerte und im 2. Akt bin ich eingeschlafen. Als wir aus der Vorstellung herauskamen sagte ich zu meinem Onkel: „Nie wieder dieses langweilige Zeug, nie wieder Wagner.“
Meine Einstellung zu Richard Wagner hat sich natürlich später gewandelt, aber denken muss ich an dieses erste Wagner Erlebnis sehr oft. Seltsamerweise bin ich Ernst Gruber nur einmal Mitte der siebziger Jahre begegnet. Wir stellten uns mit großem Brimborium und gegenseitigen Respektbezeugungen einander in der Kantine der Staatsoper vor. Dann erzählte ich ihm aber die Geschichte meiner ersten Walküre mit ihm, wir haben Tränen gelacht und das Eis war gebrochen. Natürlich habe ich den Siegmund später gesungen und auch auf CD eingespielt. Mir blieb aber immer im Kopf, wie schwer für manche Zuschauer der Zugang zu Wagner ist......
Teil 2 des Interviews mit Reiner Goldberg, sein Leben und Wirken, folgt .....
---| IOCO Interview Reiner Goldberg |---

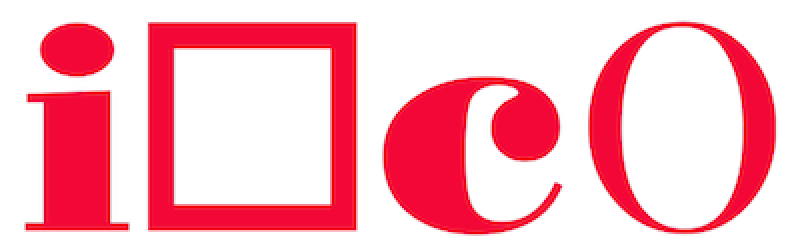

Kommentare ()