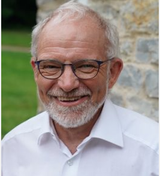Stuttgart, Staatsoper, DER SPIELER - Sergej Prokofjew, IOCO
In der kräftezehrenden Rolle des Alexej erfüllt Daniel Brenna die in ihn gesetzten Erwartungen, ja, berührt in manchen Szenen durch höchste Gesangskultur.

Das Weltall als Spielcasino und Fluchtort einer verzockten „Möchtegern-Elite“ - An der Stuttgarter Staatsoper Stuttgart begeistert am bzw. seit 2. Februar Axel Ranisch mit einer grell-sarkastischen und erschreckend aktuellen Version von Prokofjews Oper „Der Spieler“
Von Peter Schlang
Wer bisher relativ distanziert und skeptisch auf die Marspläne des neuen Trump- Freundes Elon Musk schaute oder die exklusive Idee von einem post-katastrophischen Exil auf Neuseeland als Hirngespinst einiger durchgeknallter, narzisstischer Milliardäre abtat, kann in der jüngsten Arbeit des Regisseurs Axel Ranisch und seines AusstatterInnen-Teams an der Staatsoper Stuttgart eine Vorstellung davon gewinnen, wie die Realisierung eines solch vermeintlich utopischen Vorhabens aussehen könnte.
Nach Ranischs äußerst erfolgreichen Stuttgarter Inszenierungen von Prokofjews „Liebe zu (den) drei Orangen“ 2018 und „Hänsel und Gretel“ 2022 hatte die Stuttgarter Oper den vom Film kommenden Regisseur mit der Inszenierung von Sergej Prokofjews Oper „Der Spieler“ beauftragt, die am Sonntag, dem 2. Februar ihre Stuttgarter Erstaufführung erlebte. Das vom Komponisten selbst stammende Libretto dieser 1929 in Brüssel uraufgeführten Dialog-Oper - es war Prokofjews erstes großes, abendfüllendes Bühnenwerk - basiert auf dem gleichnamigen, 1866 erschienenen Roman Fjodor Dostojewskis. In diesem verarbeitete der russische Romancier seine eigene Spielsucht, die ihn und seine Geliebte an den Roulette-Tischen deutscher Kurorte fast in die Verarmung geführt hatte.
In einem auch sprachlich an diese Erfahrung erinnernden fiktiven Ort „Roulettenburg“ lassen Dostojewski und Prokofjew eine illustre Schar vom Leben und vor allem vom Spiel gezeichneter, schlechter noch, ruinierter Figuren aus verschiedenen Nationen um Geld, Geltung, Zuneigung zum anderen Geschlecht, Unterhaltung und soziale Aufmerksamkeit buhlen und taktieren.

Eine zentrale Figur der Handlung ist der alternde General, der sich mit Verweis auf seine kurz vor dem Ableben stehende steinreiche Verwandte Babulenka ständig neues Spielgeld leiht. Sein Traum von einem Geldregen platzt jedoch, als die sterbend Geglaubte wie aus dem Nichts und putzmunter in Roulettenburg auftaucht und dort ihr gesamtes Vermögen verzockt.
Besondere und sie vom Rest der Auftretenden unterscheidende Rollen nehmen in diesem turbulenten Geschehen Polina, die Stieftochter des Generals, und Alexej, der Hauslehrer von dessen Kindern, ein. Neben dem Streben nach Geld und Reichtum steht bei ihnen fast noch mehr das Werben um die bzw. den jeweils anderen im Vordergrund, sodass sie ein verwirrendes Spiel auf zweifacher Ebene betreiben.
Wie eingangs angedeutet, verlegt das Stuttgarter Regieteam den Spielort Roulettenburg auf einen fremden Planeten, was sich nicht erst bei einem Blick in das exzellent gemachte Programmheft erschließt. Vielmehr lassen eine vor dem - projizierten - wüstenartigen Hintergrund (Projektionen: Philipp Contag-Lada) bereitstehende und dann abhebende Rakete und vor allem die sich statt des Mondes am Himmel drehende Erde vermuten, dass Ranisch und seine in Stuttgart zum dritten Mal mit ihm zusammenarbeitende Bühnenbildnerin Saskia Wunsch deutlich auf Musks Mars-Fantasien und den Traum vermögender Erdbewohner von einem scheinbar sicheren Refugium, quasi einer Ersatz-Erde als Zufluchtsort, anspielen. Auch die in diesem extra-terrestrischen Las Vegas (Aus dem Sand erhebt sich immer wieder ein halber Roulette-Teller.) tätigen Bediensteten mögen im ersten Augenblick an Marsmenschen oder andere Aliens erinnern. Im Programmheft klärt Axel Ranisch jedoch darüber auf, dass er und seine beiden Kostümbildnerinnen Claudia Irro und Bettina Werner sich bei der Kreation dieses futuristisch anmutenden Servicepersonals von der biologischen Art der Bärtierchen inspirieren ließen. Diese, so erfährt man weiter, kämen in nahezu jedem Ökosystem der Erde vor und könnten selbst unter extremsten Bedingungen überleben.
Auch die Bekleidung der gescheiterten und deutlich ramponierten Spieler/innen-Haute-Volée ist von anschaulichster Symbolik geprägt und zeugt von drastischer, ja ziemlich böser Ironie. Der von Goran Juric stimmlich wie darstellerisch äußerst überzeugend als karikaturhafte wie tragische Figur verkörperte General etwa trägt nur „oben herum“ eine Generalsuniform. Diese gleicht aber genauso wie die Kostüme anderer ProtagonistInnen den berühmten Potemkin’schen Dörfern, denn „hinten“ wird diese „Kulisse“ nur von Bändern und Schnüren zusammengehalten. So steckt die Geliebte des Generals, Mlle Blanche - mitreißend gespielt und sehr überzeugend gesungen von Stine Marie Fischer - „vorne“ in einer Abendrobe aus blauen Geschenkschleifen, während Fürst Nilskis Oberkörper - Robin Neck verleiht diesem Adligen etwas unterwürfig-Angepasstes - nur von einer gestärkten Frackbrust verhüllt wird. Beim General erkennt man aus der entlarvenden rückwärtigen Perspektive zudem, dass der einst große Befehlshaber offenbar zur Inkontinenz neigt, denn seine Unterhose besitzt große Ähnlichkeit mit einem Windelhöschen! Von ähnlicher Deutlichkeit ist das hauptsächlich aus einer Strumpfhose und einem halben Jäckchen bestehenden Kostüm des schlüpfrig-intriganten Marquis, das diesem zusammen mit diversem Accessoire die Anmutung einer queeren Person verleiht. Elmar Gilbertsson scheint diese Rolle wie auf den Leib geschneidert zu sein und lässt sich durch sie zu einer stimmlichen und komödiantischen Meisterleistung inspirieren.

Diese ironische Widersprüchlichkeit macht selbst vor dem Schuhwerk der Spielbank-Kundschaft nicht Halt, das in seiner Opulenz einen Hinweis darauf gibt, auf welch großem Fuß diese Damen und Herren gerne leben würden.
Claudia Irro und Bettina Werner schaffen es mit diesen extravaganten, opulenten und vieldeutigen Outfits, dass deren Träger einerseits noch einen Hauch von Glamour und (verblichenem) Reichtum verströmen. Bei genauem Hinsehen wird aber schnell klar, in welchem wahren Vermögens- und Charakterzustand sich diese feine Zwangsgesellschaft in Wahrheit befindet. Trotz ihrer sichtbar nach-katastrophalen Verfassung scheinen die Bewohner Roulettenburgs jedoch nichts begriffen und gelernt zu haben, sondern gehen unbeeindruckt von allen äußeren Bedrohungen ihrem narzisstischen und oberflächlichen Zeitvertreib nach. Dieser erfährt wiederum in dem in einen gold-glänzenden Anzug gekleideten Direktor der Spielbank eine ironische visuelle Spiegelung und Verstärkung. Dazu kommt, dass die Regie dafür sorgt, dass der Herr über das Spielgeld während der gesamten Spieldauer der Oper das Geschehen im Blick und ein Auge darauf hat, dass die Geschäfte für ihn gut gehen und in seinem Sinne alles einigermaßen im Lot bleibt. Shigeo Isino füllt diese Rolle mit der dazu passenden schauspielerischen Raffinesse und Doppel-gesichtigkeit aus und überzeugt auch durch seine geschmeidige, warme und unaufgeregt geführte Bassbariton-Stimme.
Komplettiert wird die am Premierenabend bis auf wenige Trübungen überzeugende Solistenschar durch drei überaus prominente Gäste: Als Polina besticht die litauische Sopranistin Aušrine Stundytê in Stimme und Spiel, was die Zerrissenheit und Verletzlichkeit dieser jungen Frau direkt körperlich spürbar werden lässt. In der kräftezehrenden Rolle ihres Widerparts, zeitweiligen Geliebten und Vielleicht-Partners Alexej erfüllt Daniel Brenna die in ihn gesetzten Erwartungen, ja, berührt in manchen Szenen durch höchste Gesangskultur. Auch die zweite Sopranistin dieses aufwändigen Opernabends, die berühmte französische Sängerin Véronique Gens, verleiht ihrer Babulenka die notwendige tragisch-schräge Doppelbödigkeit, welche in dieser Rolle steckt und mehr zu bieten hat als Spiel- und Rachsucht an ihrem respektlosen Verwandten.
Was die Vokalparts in Prokofjews Spieler betrifft, darf natürlich auch das Kollektiv, also der Chor der Staatsoper Stuttgart, nicht unerwähnt bleiben. Von Manuel Pujol erneut prächtig eingestimmt, hat er zwar nur einen großen Auftritt, den aber im turbulent-furiosen vierten Akt (Vor dem Hintergrund der künftigen Halle des neuen Stuttgarter Bahnhofs!) mit seinem gewaltigen Roulette-Beben. Faszinierend, wie die Choristen durch ihr schnelles Rotieren - und das neben dem Singen - das Drehen der Roulettescheibe suggerieren. Höchst anerkennenswert auch die Tatsache, dass etliche der kleineren Rollen aus dem Chor heraus besetzt wurden.

Ihren ganz besonderen musikalischen Stellenwert erhielt diese Produktion und Premiere durch die Tatsache, dass sie die erste Oper ist, die vom künftigen Generalmusikdirektor der Stuttgarter Oper, Nicholas Carter, geplant, einstudiert und geleitet wurde. Für den jungen australischen Dirigenten war es ein Einstand nach Maß, denn er führte das an diesem Abend fast in Maximal-Besetzung angetretene Staatsorchester nicht nur umsichtig und jederzeit sicher durch die hörbar komplizierte und höchst anspruchsvolle Partitur, sondern auch regelrecht zu einer wahren Glanzleistung. Von dieser profitierten auch die Sängerinnen und Sänger, die den von Prokofjew verlangten deklamatorischen Gesang ohne Gewaltanstrengung realisieren und dadurch eine erstaunlich hohe Textverständlichkeit erzielen konnten. Das Orchester selbst überzeugte nicht nur durch eine fesselnde Dynamik und teils mitreißende solistische Leistungen, sondern begeisterte auch mit der packenden und zielgenauen Charakterisierung der verschiedenen Figuren und dem musikalischen Erleben der vom Roulette ausgehenden Spannung und Dramatik.
Folgerichtig endete diese Premiere mit großem Jubel für alle Mitwirkenden, der niemanden ausschloss, sondern zurecht eine beachtliche künstlerische Gesamtleistung würdigte. Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Verwerfungen honorierte das Premierenpublikum damit sicher auch die Leistung der Regie, ein großes Arsenal an Anspielungen, Assoziationen und Nebenwelten aufzubieten, die den Abend zu einer psychologischen und soziologischen Fundgrube, einem Augenschmaus und einem politisch-sozialen Lehrstück werden ließen.
Weitere Vorstellungen am 20. und 23. Februar sowie am 10., 15., 19. und 30. März