GOTTSUCHMASCHINE - transhumane Komödie - Buch von Manfred Schneider, IOCO
GOTTSUCHMASCHINE - Buch von Manfred Schneider: Wie es schon anfängt. Jason, so heißt er, der durch Manfred Schneiders zweibändiges Werk mäandert. Herumhüpft, nachdenkt, gekrönt wird, dichtet, Forschungsobjekt ist und exploriert wird, mit seiner Freundin Antea schläft,
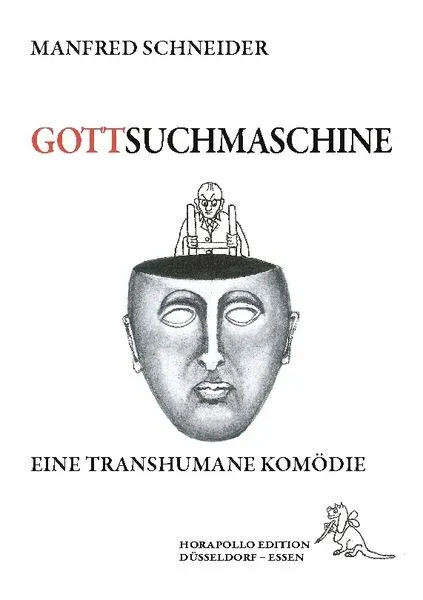
Gottsuchmaschine - eine transhumane Komödie von Manfred Schneider - Cover und Illustrationen von Albrecht Schneider - ISBN 978-3-7583-8173-7 THALIA Verlag €29,50
Besprechung von Hans Günther Melchior
Wiener Walzer aus Wörtern, Gedanken, Forschungen und anderem unter anderem
Wie es schon anfängt. Jason, so heißt er, der durch Manfred Schneiders zweibändiges Werk mäandert. Herumhüpft, nachdenkt, gekrönt wird, dichtet, Forschungsobjekt ist und exploriert wird, mit seiner Freundin Antea schläft, sie andichtet – und überhaupt. Ein verrücktes, in die Höhe schießendes, Wellen schlagendes und sich ins Lyrische verkriechendes Werk, ein Stück nachdenklicher Literatur außerdem. Ein Kunstwerk und eine Anleitung zu raffinierter Erotik, die aus der Höhe in die Tiefe, ins Allzu-Menschliche fällt und aus der Tiefe die Höhe macht.
Ein verrücktes Buch aus einem Band und immerhin 647 eng, sehr eng beschriebenen Seiten, die einem um die Ohren schlagen, was man irgendwie weiß und nicht wahrhaben und will und beschreibt, was man noch nicht wusste, aber irgendwie ahnte.
jpc Verlag - Gottsuchmaschine - €29,50 - link Hier!
Ein zuweilen tiefsinniges, philosophisches Buch. Und vor allem ein den Menschen beim Dichten und Denken zuschauendes Buch, das einem so manche Wahrheit beibringt und manche Nuss zum Knacken einfach so hinlegt, als wäre man ein Neurowissenschaftler (oder heißt es Neurowissenschafter ohne L?, wer weiß, wer kann schon was wissen, wenn er dieses Werk gelesen hat), Jason also, einer, dessen Profession es ist, dem Menschen allgemein oder ganz bestimmten Menschen beim Denken zuzuschauen und zu ergründen, wer oder was eigentlich denkt: der sich selbst in der Literatur, in der Philosophie (teilweise), in der Wissenschaft verherrlichende und verherrlichte Mensch oder dieser Denkapparat, das Gehirn, das im Grunde macht, was es will, als hätte einer auf den berühmten Knopf gedrückt, und den Apparat in Gang gesetzt und jetzt denkt er vor sich hin, nimmt die Realität wahr und zieht Schlüsse, als laufe er ihm, dem Menschen, uns, den Menschen überhaupt, einfach so davon – und wer weiß, wer kann wissen wohin.
Gott sagte es nicht, sagt Manfred Schneider, denn Gott verbirgt sich, er versteckt sich irgendwo, vorausgesetzt, es gibt ihn überhaupt, und schaut nur zu, dieser listige Fuchs von einem Deus absconditus, vielleicht auch nicht mehr als einer der vielen Götter unserer Zeit, die sich freilich nicht verbergen, sondern sich in den Vordergrund der Aufmerksamkeit drängen, als wären sie das Ein und Alles, als wären sie überhaupt wichtig.
Da ist freilich so ein Gott, ein Gott eben, den Jason meint und den Antea, seine Freundin, Sexpartnerin (es gibt da in Fremdwörter und Begriffe verhüllte Stellen, o la la) und in der Hauptsache Wissenschaftlerin sucht, immerhin, sollte es ihn überhaupt geben, ein milder, nachsichtiger Gott, einer von den obersten Oberen, der offenbar geduldig zusieht, wie die beiden Partner, die Wissenschaftlerin und ihr Freund und Forschungsobjekt, der Dichter und Künstler Jason, von Tagung zu Tagung reisen, Vorträge halten und so ganz nebenbei Gedichte drechseln. Gedichte, wie gesagt, die es zuweilen in sich haben, nun ja, der Mensch ist auch ein Tier, jedenfalls zu einem nicht geringen Teil, was solls also, er denkt und denkt und dann hat er genug davon und macht, was Menschen nunmal machen, deren angeblich göttlicher Auftrag es ist, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, und wenn sie sich nicht vermehren wollen, machen sie es trotzdem, das wofür Manfred Schneider - siehe auch im foldenden Bild - sein Wörter hat, machen es, nicht weil es lustig ist, sondern weil es Lust verschafft und befriedigt und weil es eben ist, wie es nunmal ist.

Manfred Schneider ist, wie sein Bruder Albrecht Schneider, dessen Zeichnungen, siehe oben, zeigen, was und wie es geschah, nicht minder erregend auf seine Art…, Manfred Scheider, wollte ich sagen, ist ein Sprachakrobat, der auf vielen Sprachklavieren zu spielen versteht. Ein Literaturprofessor, dem sich die Sprache anschmiegt und der es versteht, sie geschmeidig zu machen und elegant. Darüber hinaus beherrscht er sie auf vielerlei Art, nicht nur auf die wissenschaftliche, neurowissenschaftliche, sondern auch auf die poetische und nicht zuletzt auf die fremdsprachliche. Da gibt es ganze Passagen in Latein, Griechisch, Italienisch, selbstverständlich Englisch (habe ich eine Sprache vergessen? nehmen wir einfach polyglott dazu) und selbst das Deutsche kommt zuweilen auf ziemlich hohem Ross daher, kunstvoll, mal akademisch, mal am Rand des Zotigen –, bewusst natürlich, beileibe kein Vorwurf, so eben, als schaue der Autor den Leuten aufs Maul und wer weiß wohin. Und immer ist der wissenschaftliche Duktus im Hintergrund und oft sogar im Vordergrund der sprachlichen Bemühung, die gestellte Aufgabe nämlich zu klären, was sich ein Herr Overstolz (war das nicht ein Zigarettenmarke nach dem Krieg?), Leiter des Hirnforschungsinstituts sich vorgesetzt hat. Immer wieder nämlich, es sei noch einmal gesagt, vorbereitend auf das Werk eingeschärft, ob das Gehirn sich seiner Natur nach unabhängig macht vom Menschen, dieser also in Wahrheit nicht der Autor seines Denkens und seiner Gedanken ist.
Im Grunde ein nicht ermutigender Befund. Man denkt an Adornos und Horkheimers epochemachendes Werk Dialektik der Aufklärung, dessen endzeitlicher und niederschmetternder Befund letztlich und recht verstanden darin bestand, den Verstand oder genauer Die Rationalität als den eigentlichen Herrn über den Menschen und seine Entscheidungen zu stellen. Und zwar, indem er den Menschen selbst denkt, sich gleichsam, obwohl als Werkzeug gedacht, sich über den Denkapparat stülpt und ihm seine Regeln und Ergebnisse aufzwingt. Der usurpierende Verstand als der eigentliche Bestimmer und Herrscher, und zwar vermöge seines rationalen Werkzeugs, ein Herrscher, der den Menschen eben zum Objekt macht. Aufklärung in diesem Sinne wäre etwas, das sich gegen den um Aufklärung und Freiheit bemühten Menschen selbst kehrt und ihn in eine neue Diktatur, die der Rationalität, zwingt.
Aber Manfred Schneider geht noch einen Schritt weiter. Der Denkapparat selbst erscheint wie ein dem Menschen fremder Apparat. Eine Art Maschine, pure eingebaute Mechanik. „Du denkst und dichtest, aber in Wahrheit dichtet dein Gehirn“, heißt es einmal.
Was für eine dystopische Idee. Die Erforschung der neuronalen (mechanischen?) Grundlagen der Erkenntnis als letztliche Quelle des Denkens und Dichtens. Die automatische Eigenbewegung des – selbst ästhetisch produktiven – Gehirns.
Und was machen wir jetzt mit den Dichtern und Philosophen, den Genies, die in dem Buch mehrfach erwähnt werden? Benn zum Beispiel, Rilke, Gryphius. Kant, du meine Güte, Kant, ein Glaubensbruder, ja Vater der Rationalisten, der Apologet der apriorischen und aposteriorischen – wenn auch letztlich eingeschränkten (bzgl. der Dinge an sich) – Erkenntniskräfte. Alles eine Art Mechanik? Selbsttätigkeit eines Apparats?
Was für eine Gedankenfülle. Was für ein Gehirn, das für den Autor denkt. Und, ach ja: die Familie dieses – zumindest halben, zeitweiligen und zeitweilig ins Leben zurückehrenden – Schlafwandlers namens Jason. Ach, Jason. Wer denkt da nicht an Medea, nichts ans Goldene Vlies? Nicht an das tragische Ende dieser ehelichen Verbindung?
Sein Nonno, gescheit, lebensweise. Ein Alter Ego des Autors? Überhaupt diese merkwürdig fremde und doch geistig vertraute Familie.
Ein Buch der Fülle. Der Überfülle. Wer könnte es erschöpfend beschreiben? Am Schluss kommt die „Traumdeutung“ zu Wort. Als Orakelspruch. Zeitgemäß kapitalistisch für zweitausend Euro zu erwerben. Der Schluss als Wermutstropfen.
Hingegen der Anfangsschwung, was für ein poetischer Beginn: „Der erste Satz trug Jason über die Schwelle des Hauptbahnhofs. Er schwebte kaum eine viertel Sekunde. Zwei Achtelsekundensprünge folgten. Lang-kurz-kurz“…
Man schwebt mit. Was wäre Rhythmus in einem dichterischen Text, wenn es das nicht ist, was wäre dichterische Verheißung…
Lesen – und nicht aufhören können. Ein Satz zieht den anderen – und dann wir ein reißender Fluss daraus. Ein vertrackter Genuss. Selten so viel über die Frage gestolpert: Wer bin ich eigentlich? Jason, Antea, Geschöpf eines Apparats, der mich irgendwann ausspuckte? Mit all den Gedankenbrocken, die ihm ein Wind zutrieb und die er zu wunderlichen Sätzen zusammenleimte? Ecce homo.





